Man kann nicht einmal in Ruhe seinen Reisebericht fertig schreiben, denn jetzt muß es ganz schnell gehen: Nachdem der unberechenbare Diktator Saddam Hussein, ach nein, Syriens Assad diesmal, wider Erwarten UNO-Inspektoren ins Land und sogar an den Tatort sehr wahrscheinlicher Giftgaseinsätze gelassen hat, müssen die Hegemonialmächte schnell vollendete Tatsachen schaffen, bevor am Ende noch herauskommt, daß womöglich doch nicht Assads Armee das Gas eingesetzt hat. Wie in Libyen erprobt, preschen Englands und Frankreichs Außenminister schon seit Tagen mit Vorverurteilungen vor, ihr amerikanischer Kollege hat gestern nachgelegt:
“the administration has attempted to defuse calls for a military response by emphasizing the need for scientific verification that chemical weapons had in fact been used. That caution was nowhere to be found in Kerry's remarks on Monday”, meldet Foreign Policy. “White House Press Secretary Jay Carney underscored the White House view that chemical weapons were used and that Assad was responsible. "There is very little doubt in our minds that the Syrian regime is culpable," he said.”
“Wenn die Bomben auf Damaskus zu fallen beginnen”, faßt das Magazin zusammen, “Monday afternoon will be cited as the moment when the Obama administration laid out the moral case for military action in Syria.”
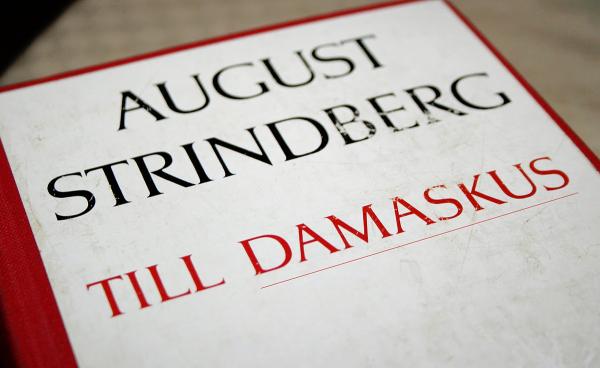
In derselben Ausgabe bringt FP einen weiteren Bericht zum Thema Giftgaseinsätze. Er beginnt mit einem ausdrücklichen Bezug auf die aktuelle Krise in Syrien:
“The U.S. government may be considering military action in response to chemical strikes near Damascus. But a generation ago, America's military and intelligence communities knew about and did nothing to stop a series of nerve gas attacks far more devastating than anything Syria has seen.”
Jetzt freigegebene CIA-Unterlagen belegen laut FP, daß die US-Regierung in den 1980er Jahren über Giftgasangriffe der irakischen Armee Saddam Husseins (!) im Krieg gegen den Iran nicht nur stets bestens im Bilde war, sondern sie durch Überlassung von Luftaufnahmen und Aufmarschplänen sogar kriegsentscheidend unterstützt hat. “They show that senior U.S. officials were being regularly informed about the scale of the nerve gas attacks.”
“ In late 1987, the DIA [Defense Intelligence Agency] analysts in Francona's shop in Washington wrote a Top Secret Codeword report partially entitled "At The Gates of Basrah," warning that the Iranian 1988 spring offensive was going to be bigger than all previous spring offensives, and this offensive stood a very good chance of breaking through the Iraqi lines and capturing Basrah. The report warned that if Basrah fell, the Iraqi military would collapse and Iran would win the war.
President Reagan read the report and, according to Francona, wrote a note in the margin addressed to Secretary of Defense Frank C. Carlucci: "An Iranian victory is unacceptable."
Subsequently, a decision was made at the top level of the U.S. government (almost certainly requiring the approval of the National Security Council and the CIA). The DIA was authorized to give the Iraqi intelligence services as much detailed information as was available about the deployments and movements of all Iranian combat units. That included satellite imagery and perhaps some sanitized electronic intelligence. There was a particular focus on the area east of the city of Basrah where the DIA was convinced the next big Iranian offensive would come. The agency also provided data on the locations of key Iranian logistics facilities, and the strength and capabilities of the Iranian air force and air defense system. Francona described much of the information as "targeting packages" suitable for use by the Iraqi air force to destroy these targets.
The sarin attacks then followed.”
Wir dürfen gespannt darauf warten, wer sich letztlich als Urheber der Giftgaseinsätze bei Damaskus herausstellt, wenn in dreißig Jahren die CIA-Akten des Sommers 2013 freigegeben werden. “Verschwörungstheoretiker” und -praktiker haben jetzt noch freies Spiel.
Nein, noch eins: Wir müssen unserer Regierung klar machen, dass sie sich nicht schon wieder aus "Nibelungentreue" an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beteiligen darf.
... link (1 Kommentar) ... comment





... link (0 Kommentare) ... comment

"Das jetzt geltende System sei das der Wirklichkeit und gleiche einem schlechten Theaterstück. Man sage nicht umsonst Welttheater, denn es erstehen immer die gleichen Rollen, Verwicklungen und Fabeln im Leben.
Vollends die erfolgreichen politischen Gestalter der Wirklichkeit haben viel mit den Schreibern von Kassenstücken gemein; die lebhaften Vorgänge, die sie erzeugen, langweilen durch ihren Mangel an Geist und Neuheit, bringen uns aber dadurch in jenen widerstandslosen schläfrigen Zustand, worin wir uns jede Veränderung gefallen lassen."
(Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, Erstes Buch, zweiter Teil)
... link (0 Kommentare) ... comment

Wann ist Montenegro eigentlich in die Wahrnehmung der internationalen Öffentlichkeit getreten? Als es im Frühjahr 2006 aus der Föderation mit Serbien austrat? Kaum. Richtig ins Scheinwerferlicht rückte es erst gegen Ende jenes Jahres, als im Auftrag Ihrer Majestät James Bond in einem Hochgeschwindigkeitszug quer durch Montenegro zum Casino Royale schoß – zum schallenden Gelächter all derer, die den Zustand des Schienennetzes in dem gerade wieder unabhängig gewordenen Ländchen kannten. (Glück für Daniel Craig, daß das Casino, in dem gedreht wurde, in Wirklichkeit gar nicht in Montenegro, sondern im tschechischen Karlsbad steht.) In Montenegro würden ICE oder TGV während der Fahrt Flugrost ansetzen, denn dort hat man es nicht eilig.
Ganz im Gegensatz zu Patrick Leigh Fermor, als er im Jahr 1960 mit dem Auto so schnell wie möglich von England durch Deutschland und den Balkan in sein geliebtes Griechenland wollte. Seinem Brief an Deborah Cavendish, Mitglied des englischen Hochadels und Dowager Duchess of Devonshire, hört man die Eile an:

“... across the Rhine, through the Black Forest, one night on the shores of Lake Constance surrounded by Germans; south into the Austrian Tyrol, on into Italy at Bolzano; then clean through the Dolomites...; north of Venice into Yugoslavia at last; through Slovenia to Lubliana, through Croatia to Zagreb, then east along a billiard table autostrada towards Belgrade... We continued south into wildest Bosnia, where mountains began to rise and minarets to sprout in every village, each alive with Moslem invocations intoned thrice daily. The roads became dust tracks across plains or twisty ledges of rubble little wider than eyebrows along the rims of deep gorges at the bottom of which huge rivers curled and swooped through echoing and forested ravines, with here and there an old Turkish bridge spanning them as thinly and insubstantially as a rainbow... So on to Sarajevo, scene of the Archduke’s murder, and, through range after range of mountains to Dubrovnik on the Dalmatian coast, a terrific medieval walled city full of renaissance palaces and belfries and winding columns and cloisters, and oysters too – huge and wonderful ones.
South of this is the old kingdom of Montenegro, now part of Yugoslavia, reached after a three-hour zigzag up a sheer and cloud-topped wall of mountain, looking down on to a strange rock fjords caked with water lilies and with pyramid-shaped mountains that hover on mist like the ones in Japanese pictures, and plenty of gliding storks. Then comes a wilderness of rock, in the heart of which lies the old capital, Cetinje.”
(aus: In Tearing Haste. Letters between Deborah Devonshire and Patrick Leigh Fermor, 2010, Brief von PLF vom 23./24.10.1960)
to be continued...

... link (0 Kommentare) ... comment

Von Serbien führt nur eine größere Straße in dieses Land der dunklen (weil bewaldeten) Berge und weiter zu seiner neuen Hauptstadt Podgorica (“Am Fuß der Berge”) im glühend heißen Becken einer bergumschlossenen Hochebene, und diese Straße führt durch die lange, gewundene und dramatisch enge und schroffe Schlucht der Morača, die von den Durchfahrenden Jahr für Jahr einen grausamen Tribut an Todesopfern eintreibt. Nur sechs Tage, nachdem wir glücklich durchgekommen sind, stürzt dort ein Reisebus aus Rumänien in die Tiefe: 16 Tote.
Wir hatten den dringenden Rat bekommen, bloß nicht im Dunkeln durch die Schlucht zu fahren, dann seien vor allem völlig übermüdete Fernfahrer auf der unbeleuchteten, kurvenreichen und schmalen Straße unterwegs. Und wir waren gut beraten, uns an diesen Tip zu halten.

Als Nachtquartier liegt Zlatibor günstig, ein Wintersportort am Fuß des 1500 Meter hohen Tornik in den Murtenica-Bergen im Grenzgebiet zu Bosnien und Montenegro. Allerdings ist der in schöner Berglandschaft gelegene Ort ein Rummelplatz der billigeren Sorte. Viele Sporthotels in einem Stil, der in den Siebzigern als modern bis futuristisch gegolten haben mag, bieten immerhin eine ausreichende Bettenzahl, um auch kurzfristig noch unterzukommen. In den Kriegsjahren der Neunziger dienten sie, das ist noch nicht vergessen, als Trainings- und Etappenlager für serbische “Spezialtruppen des Innenministeriums” (also des Geheimdienstes), während jenseits der noch umkämpften Grenzen die bosnischen Serben in Višegrad, Goražde und Srebrenica ihre Greueltaten verübten. Heute gibt sich Zlatibor wieder als Ferienidyll, dreht sich neben einem künstlichen Dorf aus Laubsäge-Holzhütten fürs Aprèsski ein Kettenkarussell, lassen Urlauber ihre Kinder Autoscooter fahren und hauen sich derweil Lappen von gegrilltem Bauchspeck rein.
Prijepolje ist dagegen ein hübsch am Lim gelegenes Provinzstädtchen, das einen vergleichsweise freundlichen Eindruck auf uns macht. Der Fluß hat die frische, klargrüne Farbe von Bergbächen, und wir kurven seinem Lauf folgend Richtung Montenegro.
Kaum zwanzig Kilometer hinter der Grenze geraten wir hinter einer Kurve in den ersten Hinterhalt der Uskoken von der montenegrinischen Polizei. Kaum können sie unser ausländisches Kennzeichen erkannt haben, fliegt auch schon die Kelle in die Höhe. Einer der beiden uniformierten Wegelagerer präsentiert uns eine Radarpistole. Ob das Gerät geeicht ist, ob die Messung wirklich von unserem Wagen stammt oder von einem vorausfahrenden, der wegen seines einheimischen Nummernschilds unbehelligt weiterfahren durfte, bleibt im Dunkeln. Nach uns donnern jedenfalls noch einige einheimische Laster mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Einer wird von den Beamten verstohlen gegrüßt. Uns verkünden sie bedauernd, aber amtlich, sie müßten unsere Papiere einbehalten, bis wir in der nächsten Stadt bei einer Bank 70 Euro eingezahlt hätten und mit der Quittung zurückkämen. Es handelt sich wohl um die montenegrinische Art der Mauterhebung, und “der Staat sind wir”, sagen sich die beiden montenegrinischen Polizisten. Wir einigen uns auf 20 Euro bar auf die Hand ohne Quittung und dürfen weiterfahren.
... link (0 Kommentare) ... comment

Tief unter den tiefsten Wurzeln der Bäume ziehen sich die Adern aus Erz durchs Kalkgestein. In jugoslawischer Zeit haben die Kumpel, die es abbauten, gutes Geld verdient, deutlich mehr als es in anderen Industrieberufen gab. Dafür nahmen sie es in Kauf, weit weg von aller Urbanität in einer Retortenstadt in den Bergen ein Leben in Schichten zu führen. Die Zeiten sind vorbei, die traditionsreiche Grube steht zum Verkauf, und Majdanpek macht den Eindruck einer sterbenden Stadt. Schon die Zufahrt zu finden, ist nicht ganz leicht. Als wir aus dem Wald kommend eine Kleeblattkreuzung erreichen, scheinen alle Abzweigungen ins Nichts zu führen: entweder sind sie nicht fertiggebaut oder sie werden nach wenigen Metern zum Feldweg, der steil bergab zu einem Baggersee zwischen Abraumhalden führt. Beschilderung? Fehlanzeige. Ein paar Radfahrer zeigen uns schließlich, wo man zwischen Betonhindernissen hindurch den Weg in die Stadt nehmen muß.

Wir fahren nach Majdanpek hinein und nach ein paar Blicken auf leerstehende Wohnblocks aus den Siebzigern so schnell wie möglich durch. Noch schlimmer ist es um die Ausfallstraße bestellt. Ich will nicht glauben, daß es die nicht einmal asphaltierte Schlaglochpiste sein soll, die sich als einzige anbietet. Wir fragen einen älteren Mann an einer Bushaltestelle. Doch, sagt er, genau die sei es, aber er würde gern ein Stück mit uns fahren, weil er ohnehin in die Richtung müsse und das Terrain etwas unübersichtlich sei.
In der Tat, das ist es. Er lotst uns erst durch schmale Gassen zum Ortsrand, dahinter öffnet sich nichts anderes als ein riesiges Baustellengelände, zerfurcht von den Riesenreifen der Erzlaster. Es dauert, bis wir diese Holperstrecke überwunden haben. Unser Lotse macht es sich unterwegs auf der Rückbank gemütlich, erzählt von einem frühen Herzinfarkt nach einem kräftezehrenden Leben und von den Bienen, die er sich danach als Frührentner zugelegt hat und die ihm irgendwie das Leben gerettet hätten. Aus seinen anfänglich sechs seien inzwischen zweihundert Völker geworden. Bienensterben? Das sei ein Problem des Westens. In einem winzigen Dorf hinter dem Grubengelände dürfen wir ihn absetzen.

Die Straße ist ab hier ein schmales Band aus Betonplatten, das durch ein enges, grün bewaldetes Tal führt. Bei Gegenverkehr wird’s eng. Aber bis Žagubica mit seiner menschenleeren Fußgängerzone kommt uns lediglich in einem Dorf mal ein Auto entgegen.
Am Quelltopf der leicht milchig grünen Mlava legen wir in einem Ausflugslokal eine Rast ein und verputzen leckere Pfannkuchen mit Pfirsichkompott, geraspelten Walnüssen und sahnigem Kaymak. Dazu gibt es unglaublich fruchtig schmeckenden Pfirsichsaft.


Hinter einer engen Schlucht beim alten Kloster Gornjak, 1378 vom Despoten Stefan Lazarević gegründet, lockern die Eichen- und Buchenmischwälder zu einer parkähnlichen Mittelgebirgslandschaft mit wiesenbestandenen Hängen und offenen Plateaus auf. An den Einmündungen von Feldwegen stehen ab und zu Autos, auf den Wagendächern Halblitergläser mit einer klaren goldgelben Flüssigkeit: Honig. Bei einem jungen Paar, das in Imkerschutzkleidung posiert, kaufen wir ein paar Gläser der lokalen Spezialität als Mitbringsel. Damit im Gepäck fahren wir der sinkenden Sonne entgegen und lassen Serbien für diesmal hinter uns.

... link (0 Kommentare) ... comment
Da uns bei der Anreise mitten im Donaudurchbruch das Gewitter unter Dach getrieben hatte und das Wetter inzwischen wieder heiterer war, beschlossen wir, noch einmal ein Stück donauaufwärts durch das Eiserne Tor zu fahren, ehe wir uns in die Wälder der serbischen Walachei schlagen wollten. Beides hat sich sehr gelohnt. Nicht mehr von Wolken und Regenschleiern verhangen, gab es fantastische Ein- und Durchblicke im Verlauf der Donauschlucht, besonders eindrucksvoll an der engsten Stelle zwischen dem Kleinen und dem Großen Kazan (“Kessel”). Mit mehr als 80 Metern ist die Donau hier einer der tiefsten Flüsse der Welt.
Auf einem Vorsprung auf rumänischer Seite, auf dem sich früher ein Signalposten zur Regulierung der Schiffahrt befand, wurde schon 1453, also im selben Jahr, in dem die Osmanen Konstantinopel eroberten, ein orthodoxes Kloster gegründet: Mraconia. Nach wechselvoller Geschichte ertranken seine alten Gebäude 1968 endgültig im angestauten Donauwasser, doch wurde es etwas oberhalb wieder aufgebaut.

Bei Donji Milanovac verlassen wir die Donau, und es folgt so ziemlich die abenteuerlichste Strecke auf unserer Reise, was den Straßenzustand angeht.
Die Berge dort sind äußerst erzhaltig (nicht umsonst heißen sie auch Srpsko rudogorje, Serbisches Erzgebirge), und man baut seit Jahrhunderten Blei-, Kuper-, Eisenerz und Gold ab; vielleicht schon seit der Antike. Eine der bedeutendsten Gold- und Kupfergruben liegt bei der Bergbaustadt Majdanpek, oder umgekehrt. Jedenfalls bedeutet ihr ursprünglich türkischer Name “Bergwerk am Pek”, und der Name des Flusses Pek geht vermutlich auf pekos zurück, ein altes griechisches Wort für Wolle und Vlies. Schaffelle aber benutzte man in der Antike, um Goldpartikel in Flüssen aufzufangen, daher ja auch das aus der griechischen Mythologie bekannte Goldene Vlies im Land Kolchis zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer, Heimat der unglücklichen Medea. Der Grieche Appian schrieb dazu Mitte des 2. Jahrhunderts in seiner Römischen Geschichte: “Die einheimischen Bewohner halten dichtwollige Schafsfelle ins Wasser, in denen sich der Goldsand fängt.”

Bis Majdanpek ist die Straße völlig in Ordnung. Meist führt sie auf Talböden zwischen dicht bewaldeten Berghängen durch kleine Dörfer oder eher an ein paar lose zusammenstehenden Bauernhäusern vorbei. Auch hier die skurrile Mischung von alten verlassenen Häusern aus lehmverputztem Holzflechtwerk und noch nicht bezogenen Neubauten. Die Gegend ist eine der am dünnsten besiedelten auf der ganzen Balkanhalbinsel, und die Abwanderung hält noch an. Vor allem seit die Regierung Miloševic den Bergbau in der Region herabgewirtschaftet hat. Wer hier noch wohnt, lebt vielleicht sogar überwiegend als Selbstversorger aus dem eigenen Garten und vom Wald. Überall schwelt nämlich Rauch aus gemauerten Meilern, in denen Wald zu Holzkohle verarbeitet wird, damit Sommerdeutschland grillen kann. Die Köhler und Bauern sind meist Vlasi, Walachen, eine Rumänisch sprechende Minderheit, die noch lange ihre Traditionen des Wanderhirtentums (Transhumanz) beibehielt. Bei Serben gelten sie als Zuwanderer aus der rumänischen Walachei östlich der Donau, nach rumänischer Sichtweise sollen sie Reste der romanischen Bevölkerung aus römischer und damit natürlich auch vorslawischer Zeit sein. Während sie sich selbst schlicht Rumänen nennen, geht ihre Fremdbezeichnung Walachen (serb. vlach) auf eine germanische Wortwurzel zurück.
Die volcae waren der dominierende keltische Stamm, auf den die vordringenden Germanen stießen und den sie ab etwa 500 v.u.Z. aus seinen Sitzen zwischen Rhein, Leine und Main nach Gallien abdrängten. Ihren leicht verballhornten Namen *walhoz, benutzten die Germanen später schlicht für alle inzwischen romanisierten Völker: welsch = romanisch.
Heute sind die serbischen Walachen meist arme Leute. Umgeben aber von der schönsten Landschaft Serbiens.

... link (0 Kommentare) ... comment



